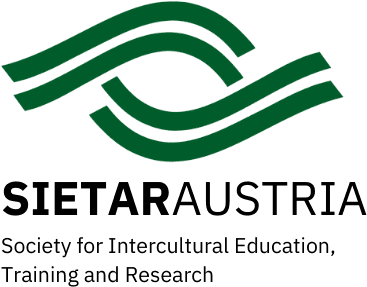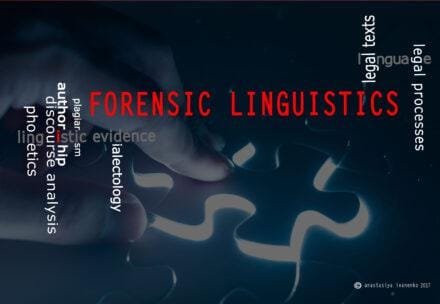Karl Kraus soll einmal gesagt haben, dass das was Deutsche und ÖsterreicherInnen am meisten trenne, die gemeinsame Sprache sei. Allerdings gibt es dieses Sprichwort gleichermaßen für Briten und Amerikaner, hier wird es wahlweise gerne Bernhard Shaw oder Oscar Wilde zugesprochen. Siehe dazu mitunter folgenden Artikel „Was die Österreicher und die Deutschen trennt“ in der Presse von 2012. Dennoch wird es bei der Unterscheidung zwischen ÖsterreicherInnen und Deutschen herangezogen und hat sich seit 1945 als „geflügeltes Wort“, also als Bonmot eingeschlichen, als ob es schon immer da gewesen wäre. Doch gilt es tatsächlich unter „verfreundeten Nachbarn“(Lackner & Thomas, 2013), dass die gemeinsame Sprache eher trennt oder gibt es nicht viel mehr Gemeinsamkeiten?
ZDF – Zahlen, Daten, Fakten
Werden die in Österreich lebenden ausländischen Staatsangehörigen nach ihrer Nationalität aufgeteilt, so sind die Deutschen die mit Abstand größte Gruppe. Am Stichtag 1. Jänner 2016 lebten mehr als 176.000 Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft in Österreich“ (Statistisches Jahrbuch des Integrationsfonds 2016, online hier). Kamen im Jahr 2015 über 17.000 deutsche StaatsbürgerInnen nach Österreich, waren es umgekehrt knapp über 10.000 ÖsterreicherInnen, die nach Deutschland abgewandert sind (Statistisches Jahrbuch des Integrationsfonds 2016, online hier). Von einer Invasion dürfte also keine Rede sein, da prozentual eigentlich mehr ÖsterreicherInnen nach Deutschland abwanderten als vice versa. Dennoch ist es wohl in einem kleineren Land deutlicher spürbar.
Deutsche Zugewanderte müssen ja meist keine neue Sprache lernen, wohl aber sich einen neuen Wortschatz zulegen: bereits an der Supermarktkassa (jawohl KASSA), kann das Wort „Tüte“ zum Verhängnis beim Integrationsfortschritt werden. Vom „Kühlschrank“, „Stuhl“, „Marille“ und „Tomate“ einmal abgesehen. Meist kennen ÖsterreicherInnen die Begriffe, die in Deutschland verwendet werden durch die gemeinsame Medienlandschaft sehr gut, umgekehrt gibt es anfangs oft Missverständnisse.
Plurizentrische Sprache?
Seit über 30 Jahren etwa hat sich in der deutschen Sprachwissenschaft das Konzept der „Plurizentrik“ durchgesetzt: dies bedeutet, dass mehrere nationale Varietäten anerkannt werden, es gibt also neben der „bundesdeutschen“ Variante genauso eine „österreichische“ oder „schweizerische“ Hochsprache, die sich von den anderen beiden unterscheidet. Österreich hat sich 1995 bei seinem EU-Beitritt 23 Wörter des Österreichischen Deutsch (ÖD) durch einen Zusatz zum Beitrittsvertrag sozusagen verfassungsrechtlich schützen lassen. Die meisten Wörter entstammen dabei aus der Kulinarik. Diese Anerkennung der jeweiligen Hochsprache liegt wohl auch darin begründet, dass SprecherInnen der österreichischen „Standardvarietät“ zumindest meinen, sich gegenüber der bundesdeutschen Varietät rechtfertigen zu müssen.
Akzeptanz und Prestige der österreichischen Hochsprache
Ransmayr (2005) führte sogar eine empirische Studie zur Akzeptanz und zum Prestige des ssterreichischen Deutsch an 23 Universitäten in Großbritannien, Frankreich, Tschechien und Ungarn durch: hierbei erfolgte eine schriftliche Befragung bei 129 DozentInnen und 780 Studierenden sowie 44 qualitative Interviews mit einem Teil der befragten DozentInnen. Das österreichische Deutsch wurde in der Praxis tendenziell als dialektal oder Substandard eingeschätzt, obwohl das Konzept der Plurizentrik zwar in der Auslandsgermanistik mittlerweile als bekannt angenommen wird. Kurzum: Österreichisches Deutsch wird oft zwar als sympathischer und „lieblicher“ wahrgenommen, die bundesdeutsche Variante aber oft als „richtiger“ und seriöser, sowohl im Ausland als auch (österreichischen) Inland. Diese unterschiedliche Wahrnehmung im Ausland erklärt dann vielleicht auch den zeitweise gefühlten Komplex von österreichischen Studierenden nach der „Invasion“ von zahlreichen Deutschen in Massenstudienfächern wie Medizin, Publizistik, Psychologie etc.
Andererseits gibt es seit einiger Zeit auch Bemühungen, die österreichische Variante zu stärken, da gerade Jugendliche vermehrt „deutschen“ Wortschatz verwenden oder auch bedingt durch den gemeinsamen Handelsraum deutsche Ausdrücke in den österreichischen (Sprach-) Alltag einziehen.
Sprache als Identitätsmittel und Grenzziehung
Sprache ist also nicht nur Verständigungsmittel, sondern identitätsstiftend – Zugehörigkeit und „Grenzverläufe“ drücken sich eben z.T. auch auf der sprachlichen Ebene aus. Diese „ingroup“- bzw. „outgroup“-Zuordnungen zeigen sich dann eben auch im interkulturellen Kontakt zwischen Deutschen und ÖsterreicherInnen, nicht nur sprachlich, sondern teilweise im Arbeitsleben auch als eine Form der Marginalisierung. Thomas Köllen und Julia Greth (2016) sind diesem Phänomen in einem Forschungsprojekt an der WU Wien nachgegangen und haben dabei herausgefunden, dass West-EuropäerInnen zwar eher selten einer marginalisierten Gruppe zugeordnet werden, Deutsche in Österreich aber negativer assoziert sind als umgekehrt. Dies führt u.U. auch dazu, dass einige nach Deutschland zurück kehren, da sie Erfahrungen von Exklusion und Diskriminierung machendie deutschen Zugewanderten angekommen, desto mehr minimiert sich die dieser Effekt laut Studie. Gründe dafür sieht Köllen (2017) historisch bedingt: ÖsterreicherInnen mussten sich nach 1945 klar von Deutschland abgrenzen und somit eine eigene Identität gegen Deutsche konstruieren: durch mediale Unterstützung innerhalb Österreichs, die kaum je Aufmerksamkeit in Deutschland erregte, konnte sogar in den Massenmedien das negativere Bild Deutschlands errichtet werden, quasi ohne Gegenwehr und zur eigenen Selbstaufwertung. So, sagt Köllen, sei das „Piefke-Bashing“ salonfähig geworden, auch mitunter in eher vermeintlich links-liberal-intellektuellen Milieus. Österreichisch zu sein bedeute auch zu einem großen Teil, NICHT deutsch zu sein.
Umgangstrategien?
Einige Deutsche würden laut Köllen & Greth (2016) auch erfolgreiche Gegenstrategien wie Humor oder Herunterspielen erfolgreich anwenden, um mit diesem Phänomen umzugehen. Gerade bei österreichischen Vorgesetzten würden auch positive Stereotype durch die „deutschen Tugenden“ wie Pünktlichkeit, Verlässlichkeit etc. greifen, die auf deutsche MitarbeiterInnen projiziert werden. Dies bringt ihnen dann eben z.T. Vorteile, bei KollegInnen auf derselben Hierarchie aber eben nicht. Diese Erfahrungen des „othering“, also zu etwas Fremden gemacht werden inklusive Zuschreibungen erleben nicht nur Deutsche – ein ähnliches Phänomen gibt es bei anderen Grenzländern genauso: sei es zwischen Frankreich und Belgien, USA und Kanada u.v.m. Hier ziehen Köllen & Greth (2016) auch die stärksten Vergleiche. Mit diesen Ambivalenzen unter „Verfreundeten Nachbarn“ (Lackner & Thomas, 2013) gilt es also beidseitig umgehen zu lernen. Wie damit umgegangen werden kann, ist Fokus einer Veranstaltung von SIETAR Austria am 05. Juli 2017 (Start 18:30 Uhr) im Expat Center Wien (Schmerlingplatz 3, 1010 Wien).
Sie möchten mehr zum Thema erfahren?
Veranstaltungsempfehlung SIETAR Austria Culture Talk : Mittwoch, 05. Juli 2017/18:30 Uhr @Expat Center
Lost in Translation: Piefkenesisch: österreichisch.
Innerhalb des letzten Jahrzehnts hat sich die Zahl der deutschen ArbeitnehmerInnen in Österreich beinahe verdoppelt, doch wie gut sind die „Piefkes“ integriert und worin unterscheiden sich die Herausforderungen von denen anderen Expats? Darüber werden Saskia Lackner und Karin Spitra diskutieren und den TeilnemerInnen dieses Abends gängige „Übersetzungsfehler“ nahe bringen. Und wie man diese vermeiden kann.
Speaker: Dipl.-Psych.in Saskia Lackner & Mag.a Karin Spitra. Mehr Info hier!
www.sietar.at Einladung und nähere Information hier. Contact info@sietar.at
Literaturempfehlungen:
Bücher:
- Saskia Lackner & Alexander Thomas (2013): Beruflich in Österreich: Trainingsprogramm für Manager, Fach- und Führungskräfte. Vandenhoeck & Ruprecht.
- Torsten Schönberg (2016): Piefke 5 – der Stempelmörder.
Artikel:
- Barbara Corvarrubias Venegas & Saskia Lackner(2015): Interkulturelle Kompetenz unter Nachbarn. Abrufbar hier!
- Bundesministerium für Bildung und Frauen: Österreichisches Deutsch als Unterrichts- und Bildungssprache. Abrufbar hier!
- Die Presse (2012): Was die Österreicher und die Deutschen trennt. Abrufbar hier!
- Interview Thomas Köllen Vice Austria (2017): Wir haben einen Experten gefragt, warum wir Deutsche so hassen. Abrufbar hier!
- Österreichischer Integrationsfonds (2016): Migration & Integration. Zahlen. Daten. Indikatoren 2016. Abrufbar hier!
- Ransmayr, Jutta (2005): Das österreichische Deutsch und sein Status im Ausland, Wien.
- Rudolf de Cillia (2005): Varietätenreiches Deutsch Deutsch als plurizentrische Sprache und DaF-Unterricht. Abrufbar hier!
- Thomas Köllen & Julia Greth (2016): Perceived Anti-Germanism in Austria. Abrufbar hier!
Autorinnen:
Saskia Lackner ist als Lektorin und Trainerin u.a. an verschiedenen Hochschulen tätig, und unterstützt neuerdings die Kommunikationsabteilung der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst. Saskia ist Diplom-Psychologin mit dem Schwerpunkt Interkulturelle Psychologie sowie einem Zusatzstudium „Internationale Handlungskompetenz“ der Universität Regensburg. Von 2012 bis Jänner 2017 war Saskia wissenschaftliche Mitarbeiterin & Lektorin am Institut für Kommunikation, Marketing & Sales der FHWien.
Barbara Covarrubias Venegas ist Forscherin und Lektorin am Institut für Personal & Organisation der FHWien der WKW. Sie studierte und arbeitete in Österreich, Spanien, Italien, Chile und Mexiko. Nach ihrer Tätigkeit als Marketing-Beraterin im Tourismusbereich, und als Bereichsleiterin im Food & Beverage für die größte südamerikanische Casinokette, spezialisierte sie sich auf Trainings und Beratungen im internationalen Kontext.